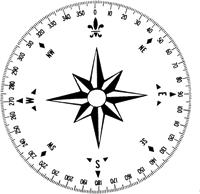| 44
Schleswig-Holsteiner 'Auf den Spuren der niederdeutschen US-Auswanderer' Am
10. Okt. 2001 startete, wie im letzten
Jahr, eine Reisegruppe aus Schleswig-Holstein auf den Spuren plattdeutscher
Einwanderer durch den Mittleren Westen der USA, geführt und vorbereitet von
Prof. Joachim Reppmann, Ingo Reppmann und Dietrich Eicke. Verlief die Reise im
letzten Jahr in erster Linie auf den Spuren der schleswig-holsteinischen Siedler,
so führte sie diesmal auf den Wegen der Auswanderer aus dem gesamten plattdeutschen
Sprachraum. Ausgangspunkt der Reise war die Metropole St. Louis im US-Bundesstaat
Missouri. Von dort ging es westlich den Fluss Missouri hinauf in die kleinen Städte:
Hermann, Cole Camp und Concordia. Dann nach Hannibal, den Ort am Mississippi in
dem Mark Twain aufgewachsen ist und in dessen Umgebung seine Tom Sawyer und Huckleberry
Finn Geschichten einmal gespielt haben. Weiter führte die Fahrt mit dem Bus,
wie im letzten Jahr, quer durch Iowa von Davenport nach Grand Island in Nebraska,
wo die Reisenden an der 4. Plattdüütsch Konferenz teilnahmen. In Omaha,
Nebraska startete der Rückflug über Chicago und München nach Hamburg.
 St.
Louis, die Stadt im Staate Missouri gelegen, wo der gleichnamige Fluß in
den Missisippi mündet, wurde, wie der Name erkennen läßt von Franzosen
gegründet. Obwohl viele Deutsche in Jahren von 1840 - 1860 sich in St. Louis
ansiedelten und im Jahre 1860 50% der Einwohner Deutsche waren, beherrscht noch
heute der französische Charakter die Stadt, die einst durch Pelzhandel reich
geworden und dessen französischen Familien von der Gründerzeit bis in
die Gegenwart zu den finanzkräftigsten und einflußreichsten Einwohnern
der Stadt gehören. St.
Louis, die Stadt im Staate Missouri gelegen, wo der gleichnamige Fluß in
den Missisippi mündet, wurde, wie der Name erkennen läßt von Franzosen
gegründet. Obwohl viele Deutsche in Jahren von 1840 - 1860 sich in St. Louis
ansiedelten und im Jahre 1860 50% der Einwohner Deutsche waren, beherrscht noch
heute der französische Charakter die Stadt, die einst durch Pelzhandel reich
geworden und dessen französischen Familien von der Gründerzeit bis in
die Gegenwart zu den finanzkräftigsten und einflußreichsten Einwohnern
der Stadt gehören.
Das Wahrzeichen von St. Louis ist der Gateway Arch,
ein 192 Meter hoher Torbogen direkt am Missisippi. Das aus Edelstahl geformte
Bauwerk wurde 1965 zur Erinnerung an die Besiedelung des Westens errichtet. Man
nennt es auch das 'Tor zum Westen'.
Durch ein Gebiet, das an eine etwas abgeschliffene
Mittelgebirgslandschaft erinnert, ging die Reise weiter westwärts, entlang
des Missouriflusses. Die Straße gesäumt von kleinen, in buntem Herbstlaub
leuchtenden Wäldern, grünen Wiesen und grauen Feldern. In den Jahren
1821/23 hatte Gottfried Duden in einem buntschillernden Reisebericht diese Gegend
an
den Ufern des Missouris mit den Weinbaugebieten entlang des Rheines verglichen
und viele Deutsche herbeigelockt, die in der engen Heimat, vergebens nach eigenem
Land gesucht hatten.  Den
kleinen, unbedeutenden Ort Holstein durchfahren wir langsam ohne Aufenthalt. Die
Stadt Hermann (2700 Einw.), die nächste Station der Reise, erhielt ihren
Namen im Gedenken an Hermann den Cherusker. Nahe liegt, das die ersten Siedler
des Ortes aus dem Teutoburger Wald kamen. Die Straßennamen wie Goethe-,
Schiller-, Gutenberg- und Mozart Street, sprechen für sich selbst. Die Stone
Hill Winery, ein großes Weingut, mit einem Restaurant, einem Andenkenladen
und mehreren Probierstuben, beweist noch heute, daß Georg Dudens Vergleich
mit dem Weinanbaugebiet des Rheines, durchaus berechtigt war. Den
kleinen, unbedeutenden Ort Holstein durchfahren wir langsam ohne Aufenthalt. Die
Stadt Hermann (2700 Einw.), die nächste Station der Reise, erhielt ihren
Namen im Gedenken an Hermann den Cherusker. Nahe liegt, das die ersten Siedler
des Ortes aus dem Teutoburger Wald kamen. Die Straßennamen wie Goethe-,
Schiller-, Gutenberg- und Mozart Street, sprechen für sich selbst. Die Stone
Hill Winery, ein großes Weingut, mit einem Restaurant, einem Andenkenladen
und mehreren Probierstuben, beweist noch heute, daß Georg Dudens Vergleich
mit dem Weinanbaugebiet des Rheines, durchaus berechtigt war.
Eine ehemalige
Schule, heute Museum, etwa um 1871 gebaut, gewährt Einblicke, wie die Kinder
in der Pionierzeit einmal englisch und deutsch gelernt haben. Kinderbücher,
wie der Struwwelpeter, zeigen die Verbundenheit mit der alten Heimat.
Sehenswert
ist auch das ‚Deutschheim Museum', in dem mehrere Häuser aus der Poinierzeit,
entlang einer Straße, als Museum restauriert wurden. Nicht nur die dort
gesammelten Inneneinrichtungen, wie Küchen, Stuben und Schlafräume vermitteln
Einsicht in die Lebensbedingungen der Pionierzeit, nein, auch die gesammelten
Weinpressen, Flachsbrecher und Webstühle, Holz- und Eissägen, Sensen
und Sicheln, Pflüge und Spaten, Gerätschaften, wie sie auch hier in
jedem Heimatmuseum zu finden sind, zeugen davon, mit welch harter Arbeit die Menschen
in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihr Brot verdient haben.
Wie dünn auch
gegenwärtig dieser Landstrich besiedelt ist, läßt sich einer Bemerkung
der deutschsprechenden Museumführerin entnehmen, als sie sagte: "Im
gesamten County (Landkreis) Leben 13.000 Menschen und 20.000 Rehe."
In
Cole Camp, der südwestlichen Ecke des Staates Missouri, wurde unsere Reisegruppe
vom dortigen Männergesangverein mit dem Schleswig-Holstein-Lied empfangen,
dem noch einige Volkslieder und Evergreens 'Wie Kornblumen blau', und 'Warum ist
es am Rhein so schön', folgten. Dabei hielten sie Spruchbänder mit der
Aufschrift: 'Willkommen Schleswig-Holsteiner' und 'Hannen över See', in die
Höhe. Aber auch ein Fernsehteam von Radio Bremen, das fortan die Gruppe begleitet,
filmte die Ankunft der Gäste und die Begrüßung durch den US-Bürgermeister.
Bei den folgenden Gesprächen, hörte das geübte Ohr sofort, daß
viele Cole Camper ein gutes Platt sprechen. Ein Platt, wie es heute noch südlich
der Elbe zwischen Hamburg und Bremen zu hören ist. Hella Albers, Sprachhistorikerin
aus Zeven, bestätigte dann auch, daß in den Gründerjahren vor
160 Jahren 80% der Leute im Ort aus der Ungebung von Zeven gekommen waren, wie
sie bei Ihrer Examensarbeit herausgefunden hatte.

In
diesem Hotel in der Nähe von Cole Camp wurden die deutschen Gäste schon
von der Werbesäule des Hauses freundlich willkommen geheißen
Das
Abendessen am Sonnabend, dem folgenden Tag, wurde etwas außerhalb des Ortes
eingenommen. Das Lokal war ein besserer Schuppen, von innen mit ungehobelten Holzwänden
verkleidet. Einfache Holzbänke dienten zum Sitzen an rustikalen Tischen.
Es gehört Mennoniten, einer strenggläubigen Sekte, die einmal von Ost-
und Westfriesland ausgewandert war. Es war ein Familienbetrieb, die Töchter
bedienten. Sie waren schlicht, aber bestechend reinlich gekleidet mit einer kleinen
Haub auf dem hinteren Kopf. Das Büfett war erlesen und schmackhaft, ein Genuß,
die Preise solide. Während wir aßen, sangen die Söhne mit guter
Stimme einige Gospellieder und ernteten großen Beifall. Unterdessen hatte
sich vor dem Lokal eine lange Schlange gebildet, die auf einen freien Platz im
Gastraum wartete. Als wir gingen, erfuhren wir, daß die nun in das Lokal
einrückenden schon eine Stunde gestanden hatten, und noch immer warteten
viele Menschen hinter ihnen.
In der Umgebung, so wurde uns gesagt, leben viele
Mennoniten. Sie sind geachtet und wegen ihrer sauberen Arbeit und der guten Arbeitsmoral
als Handwerker begehrt.
'De plattdüütsch Vereen von Cole Camp' hat
auch eine plattdeutsche Theatergruppe. Sie spielt einmal im Jahr; zu ihrer Aufführung
reisen Gäste von weit an. Diesmal waren es elf Sketche. Die Pausen wurden
mit kurzen Geschichten überbrückt. Auch die deutschen Gästern fanden
Gelegenheit etwas darzubieten.
Es folgte ein allgemeiner Umtrunk mit einem
kleinen Imbiß. Eine Akkordeonspielerin sorgte mit alten Ohrwürmern
für Unterhaltung. Die Stimmung stieg, das Tanzbein lockte.
Über Concordia,
dessen plattdeutscher Verein ebenfalls eine Theatergruppe unterhält, und
Hanibal am Missisippi, ging es nordwärts nach Davenport in den Bundesstaat
Iowa. Dort, während der nächsten beiden Nächte bei privaten Gastgebern
untergebracht, lernten die Reisenden amerikanische Gastfreundschaft in ihrer heimischen
Umgebung kennen. In Davenport, einst Mittelpunkt deutscher Einwanderer,
befindet sich nahe am Ufer des Mississippis, des Vaters aller Ströme, das
1994 gegründete German- American
Heritage Center. Es war einmal ein Hotel, das Neuankömmligen die erste Bleibe
bot, bis sie weiter in den Westen zogen. Die Vereinigung hat es sich zur Aufgabe
gemacht die Erinnerung an die Vergangenheit für künftige Generationen
wieder zu entdecken, so der Vorsitzende, Stanley M. Reeg. Noch aber gilt seine
Sorge das alte Gebäude zu sanieren und weiter auszubauen. Zwar sind der Neuaufbau
der Fassade zum River und der Ausbau des Erdgeschosses abgeschlossen, aber man
brauche noch Räume in den oberen Stockwerken, um weitere Unterlagen für
die Ahnenforschung zugänglich zu machen. American
Heritage Center. Es war einmal ein Hotel, das Neuankömmligen die erste Bleibe
bot, bis sie weiter in den Westen zogen. Die Vereinigung hat es sich zur Aufgabe
gemacht die Erinnerung an die Vergangenheit für künftige Generationen
wieder zu entdecken, so der Vorsitzende, Stanley M. Reeg. Noch aber gilt seine
Sorge das alte Gebäude zu sanieren und weiter auszubauen. Zwar sind der Neuaufbau
der Fassade zum River und der Ausbau des Erdgeschosses abgeschlossen, aber man
brauche noch Räume in den oberen Stockwerken, um weitere Unterlagen für
die Ahnenforschung zugänglich zu machen.
Aus Viktor, der nächsten
Station gut 150 Km westlich von Davenport, hat Jürnjakob Swehn einst seine
Briefe an seinen einstigen Lehrer Gillhoff nach Glaisin, Mecklenburg geschrieben,
die in dem plattdeutschen Bestseller 'Jürnjakob Swehn der Amerikafahrer'
veröffentlicht wurden. Lange Zeit hat man vergeblich nach den Namen Swehn
in Iowa gesucht, bis man über den Umweg, der in dem Buch genannten Namen
seiner Freunde, herausfand, daß der Name Swehn eine Erfindung des Verfassers
war und der Schreiber dieser Briefe der 1913 verstorbene Carl Wiedow sei. Harold
Wiedau, heute 93 Jahre alt, erinnerte sich noch an seinen Großvater. Von
seinen Briefen in die Heimat, sowie von der Existenz des Buches, hatte er erst
vor fünf Jahren erfahren.
Nach einer Besichtigung des 1999 in Offenseth
bei Elmshorn abgebrochenen und in Manning, Iowa wieder errichteten Bauernhauses
aus dem Jahre 1660, fand man im Ort abermals bei privaten Gastgebern Unterkunft
für die Nacht.
Danach ging es durch die kleinen Orte Schleswig und Holstein
weiter nach Grand Island in Nebraska, wo die 4. Plattdüütsch Konferenz
vom 19. - 21.Okt. 01 abgehalten wurde.
Vor 256 offiziellen Teilnehmern aus
22 US-Bundesstaaten, sowie 72 aus Europa angereisten Gästen und vielen Mitgliedern
der gastgebenden Vereine, eröffnete Professor Joachim Reppmann, Präsident
der American/Schleswig-Holstein Heritage Society, nachmittags am 19.10.01 das
Treffen unter dem Motto 'Plattdüütsch as Moderspraak in Amerika'. Organisiert
und ausgerichtet wurde es von den Mitgliedern der lokalen ‚Liederkranzgesellschaft'
und der ‚Platt Duetschen Corporation' in Grand Island. Ziel der Veranstaltung
war es, die plattdeutsch Sprechenden aus dem Norden Deutschlands mit den noch
plattdeutsch sprechenden Amerikanern des Mittleren Westens einander näher
zu bringen und neue Freundschaften zu knüpfen.
Eingehend sprach Veranstaltungsleiter
Reppmann von seiner Forschung über den Verbleib der einstigen Auswanderer
aus Schleswig-Holstein im Mittleren Westen, die er zusammen mit seinem Freund,
Dietrich Eicke, Bad Oldesloe seit 1978 durchführt. Diese Tätigkeit habe
viele Kontakte mit sich gebracht und schließlich zur Gründung der American/
Schleswig-Holstein Heritage Society 1989 geführt. Die nächsten Konferenzen
werden vom 24.-26. Juni 2002 in Bredenbek, im Oktober 2003 in Manning, Iowa und
2004 in Lunden, Dithmarschen stattfinden.
Ken Gnadt, der deutschstämmige
Bürgermeister von Grand Island (43.000 Einwohner), hieß die Teilnehmer
willkommen und Mike Johanns, Gouverneur von Nebraska und selber Nachkomme deutscher
Vorfahren, wünschte den Gästen aus Deutschland eine schöne Zeit.
Udo Fröhlich, der Bürgermeister von Bad Segeberg, Grand Islands
Partnerstadt, überbrachte Grüße von dem Landtagspräsidenten
Heinz-Werner Arens, und sprach danach im Namen der Bürger seiner Stadt, sein
Mitgefühl mit den Opfern und deren Angehörigen in New York aus.
Schon
1884 wurde, so Edith Robbins, Konferenzreferentin, die erste plattdeutsche Vereinigung
in Grand Island gegründet. 1889/90 gab es so gar ein plattdeutsche Publikation.
Sie nannte sich ‚Weltblatt', erschien wöchentlich, erreichte aber leider
nur 15 Ausgaben.
Der Schützenpark, etwas außerhalb des Ortes an
einer Anhöhe gelegen, war in den Jahren um 1900 der Treffpunkt der deutschen,
hauptsächlich schleswig-holsteinischen Einwanderer in Grand Island. Dort
trank man sein Bier und feierte seine privaten und öffentlichen Feste, wie
Schützenfest und Ringreiten. Diese Lebensweise war dann auch ein Ärgernis
der frommen Engländer und Iren, die am Sonntag zur Kirche gingen und im Tun
der Deutschen den Feiertag geschändet sahen.
Bis 1930 sprachen die deutschen
Siedler in Grand Island miteinander ausschließlich plattdeutsch, danach
wurde mehr und mehr englisch gesprochen.
‚Routes to the Roots', war das
Thema von Dr. Wolfgang Grams aus Oldenburg. Briefe deutscher Auswanderer aus Indiana
hatten ihn neugierig gemacht und er beschloß die Wege der niedersächsischen
Auswanderer in die 'Neue Welt' zu erforschen. Hierzu nutzte er in erster Linie
die Passagierlisten deutscher Reedereien und die Einwanderungslisten von Ellis
Island.
In wieweit sich die plattdeutsche Sprache aus ihrer niedersächsischen
Heimat in Cole Camp, Missouri erhalten hat, fand Hella Albers für ihre Examenarbeit
mit Hilfe von vergleichenden Tonbandaufnahmen heraus. Das Resultat ihrer Mühen
war: Viele Bewohner von Cole Camp sprechen noch ein gutes Platt. Manche Worte,
die in Zeven nur noch von den Alten verstanden werden, leben dort noch in ihrer
ursprünglichen Bedeutung. Zum Beispiel das Wort ‚strieken' für
bügeln oder plätten, so auch ‚afbern' für tauen. Andere Worte
sind verschollen. Aber es wurden auch viele Worte, die es in der alten Sprache
nicht gab, aus dem Englischen übernommen und plattdeutsch eingefärbt.
Die Betonung, der Klang der Sprache, ist aber in jedem Fall erhalten geblieben.
Zudem erzählen die Älteren, sie seien in Cole Camp alle in eine kirchliche
Schule gegangen, in der morgens deutsch und nachmittags englisch unterrichtet
wurde.
Als man 1989, zur 150 Jahrfeier der Auswanderung, erstmalig ein deutsch-amerikanisches
Familientreffen organisierte, schien es, als hätte es die Jahre der Trennung
nicht gegeben.
"De Prester un de Hund, verdeent sien Geld mit den Mund",
meinte Dr. Richard Trost, Des Moines, Iowa. Der pensionierte US-Pastor hat vor
einem Jahr den plattdeutschen Briefroman ' Jürnjakob Swehn der Amerikafahrer'
ins Englische übersetzt. Zudem beabsichtigt er 'Kein Hüsung' (Kein Zuhause)
von Fritz Reuter ins Englische zu übertragen. Schließlich seien in
jenen Tagen, als Reuter das Buch schrieb, 1/3 der Bevölkerung von Mecklenburg
nach Amerika ausgewandert. Trosts Vortrag gipfelte dann mit den Worten: "Wo
du auch lebst, vergesse nie die Wurzeln deiner Herkunft. Ik bün pattdüütsch
gebor'n, heff toerst plattdüütsch weent un heff erst veel later dat
Engliche lernt."
Die vielen Dialekte der plattdeutschen Sprache in Amerika
erforscht Prof. Bill Keel aus Lawrence, Kansas mit seinen Doktoranden Mike Putnam
und Helmut Tweer. Sie lassen vorgegebene englische Sätze von verschieden
plattdeutsch sprechenden übersetzen, um so die Unterschiede der Idiome herauszufinden
und zu lokalisieren. Bei ihrer Arbeit stießen sie auch auf eine grosse Gruppe
Mennoniten, die einmal von Norddeutschland nach Südrußland ausgewandert
waren, von dort nach Mexiko zogen und nun auf den Schlachthöfen in Kansas
als billige Arbeitskräfte schwerste Arbeit leisten. Erstaunlich ist, so Bill
Keel, daß die tägliche Umgangssprache dieser Leute noch immer das Plautdietsch
ist, das ihre Vorfahren vor sehr vielen Jahren in der Heimat sprachen. Weder das
Leben in Russland noch im spanisch sprechenden Mexiko hat ihre Sprache beeinflußt.
Ja, man müsse nun, die immer noch ausschließlich plautdietsch sprechenden
Kinder erst einmal englisch lernen lassen, damit sie am Schulunterricht teilnehmen
können.
Als Professor Keel einige Sätze ihrer Sprache phonetisch
nachsprach, war der Sinn des Satzes zum Teil nur schwer verständlich, doch
aus dem Klang und dem Tonfall der Worte hörte man sofort heraus, daß
diese Sprache einmal in West- und Ostfriesland gesprochen worden war.
Für
musikalische Einlagen sorgte Ute Biemöller aus Lohe-Rickelshof, Dithmarschen.
Sie spielte auf dem Akkordeon und lud zum Mitsingen ein. In 13 Grand Island Schulen,
vor insgesamt 1000 Kindern, hatte sich die pensionierte Grundschullehrerin in
den Tagen vor der Konferenz mit Hilfe von Liedern bemüht, in den Zuhörern
die Neugier auf die plattdeutsche Sprache zu wecken.
Nach einem gemeinsamen
Dinner krönte Hans Gudegast, mit einer zu Herzen gehenden Rede, den Tagesausklang.
Er ist in Bredenbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgewachsen und in jungen
Jahren ausgewandert. Heute lebt er als der bekannte Schaupieler Eric Braeden in
Hollywood. Seine Rede, ein Rückblick auf sein Leben im Spiegel der Zeit,
stand unter dem Motto: ‚Ich erinnere mich an meine Jugend in Bredenbek, an
die Kriegsjahre und als Hamburg in der Nacht zum 25. Juli 1943 bombardiert wurde.
Fast 100 Km vom Ort des Geschehens sahen wir die riesigen Rauchwolken über
der zerbombten und brennenden Stadt aufsteigen. Ich erinnere mich an die Not der
Nachkriegsjahre, mein Vater war im Krieg zum Krüppel geschossen, meine Mutter
hatte ihre Not für uns zu sorgen. Ich erinnere mich, als ich Abschied nahm
von der Alten Welt, wie ich mit dem Auswandererschiff ‚Hanseatic' in New
York ankam und an die ersten Jahre in Amerika, in denen ich mich mühsam durchschlug.
Ich erinnere mich, wie ich in noch den frühen 60er Jahren als Deutscher in
Amerika manches Mal angefeindet wurde, an meine Anfänge in Hollywood, sowie
an die Jahre der Erfolge.' Zum Schluß seiner Rede sprach er vom Geschehen
in New York und bedauerte, daß die Solidaritäts- und Beileidskundgebungen
in Deutschland für die Opfer und die Hinterbliebenen der Katastrophe in amerikanischen
Medien kaum erwähnt wurden, und somit im Lande weitgehend unbekannt sind.
Zum
Ausklang der Tagung am Sonntag hielt Pastor Alfred Rodewald aus Concordia, Missouri
einen plattdeutschen Gottesdienst.
In einer allgemeinen Diskussion, die abschließend
folgte, sprach Yogi Reppmann von der Absicht, daß in den amerikanischen
Sprachinseln erhaltene Plattdeutsch auf Tonbändern zu konservieren, um es
für die Nachwelt zu erhalten und um den sich abzeichnenden Niedergang der
Plattdeutschen Sprache entgegen zu wirken. Ob dieses Vorhaben zu einem Erfolg
führt, wurde bezweifelt. Zwar sprechen noch viele Nachkommen der in dritten
Generation in Amerika lebenden niederdeutschen Auswanderer noch ein verständliches
Plattdeutsch, doch die fließende Sprache ihrer Groß- und Urgroßeltern
ist es nicht mehr. Überall zeigen sich starke Einflüsse der englischen
Amts- und Umgangssprache. Somit dürfte es schwer werden, hier im fernen Mittleren
Westen noch ein Plattdeutsch zu finden, wie es die ersten Siedler des Landes einmal
geprochen haben.
Ob das Mühen diesseits und jenseit des Teiches die plattdeutsche
Sprache zu fördern und zu erhalten, Erfolge hat, wird die Zeit beantworten.
Aber noch sieht es düster aus, denn hier wie dort, beklagt man, daß
Kinder und Enkel die plattdeutsche Sprache nicht mehr annehmen wollen.
Abschließend
sei gesagt: Wenn die 4. Plattdüütsch Konferenz in Grand Island den Erhalt
der plattdeutschen Sprache auch keine neuen Impulse geben konnte, so hat sie doch
sehr viel zum besseren Kennenlernen der Menschen zwischen der Alten- und Neuen
Welt beigetragen. Viele Freundschaften wurden geschlossen, viele Händedrücke
über den Großen Teich wurden gefestigt. Und das ist auch ein Erfolg!
|